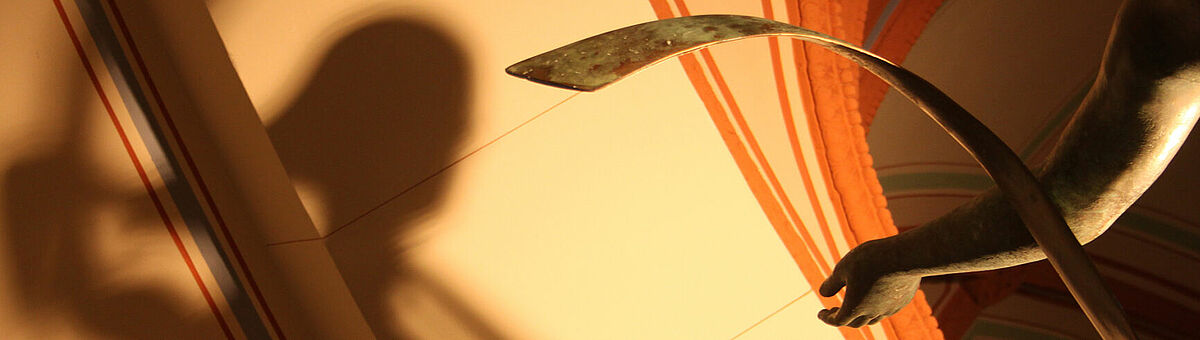Digitale Hermeneutik (DH)
WKT-Forschungsschwerpunkt
Im WKT-Forschungsfokus seit April 2021: Analysen digitalisierten Wissens anhand von Texten, Ausgrabungsgegenständen, Filmen, Musik, Körperdaten etc. durch innovative computerbasierte Analyse- und Netzwerkverfahren. Details
WKT Termine
WKT-Koordination
Inga Bork
Albert-Einstein-Straße 21
18059 Rostock
Tel.: +49 381 - 498 8903
E-Mail: wktuni-rostockde